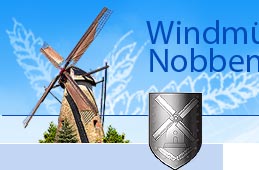

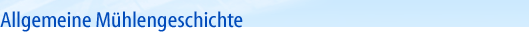
Ruisdael: Die Mühle von Wijk bei Duurstede Windbetriebene Mühlen gibt es bereits seit dem Mittelalter. In Persien, dem heutigen Iran, baute man einfache Windmühlen vermutlich schon im 10. jahrhundert. Sie dienten vor allem zur Bewässerung und zum mahlen von Getreide. Bei den ersten Windmühle war das Windrad mit Segeln horizontal gelagert und trieb eine vertikal stehende Achse an. Diese Vorrichtungen waren zwar nicht sehr leistungsstark, aber sie erleichterten den Menschen einige Arbeiten. Die dahinter stehende Technik verbreitete sich im Laufe der Zeit bis nach China und dem mittleren Osten. Die ersten Windmühlen in Europa stammen aus dem 12. und 13.Jahrhundert. In Fachkreisen wird angenommen, dass diese Technik auch über die Kreuzzüge nach Europa gelangte. Bei der im 13. Jahrhundert entwickelten deutschen Bock-Windmühle musste die gesamte Holzkonstruktion von Hand um einen Mittelpfosten gedreht werden, um die Flügel in den Wind zu stellen. Mit ihr trieb man Maschinen zum Mahlen von Getreide sowie Vorrichtungen für andere Maschinen an. Die holländische Mühle (Turmmühle, Kappenmühle) entstand während des 15. Jahrhunderts. Sie bestand aus einem feststehenden Steinturm, auf dessen Spitze die drehbare, aus Holz konstruierte Haube bzw. Kappe das Windrad sowie den oberen Teil des Mühlengetriebes trug. Alle früheren Windmühlen besitzen einige gemeinsame Merkmale: eine horizontal laufende Hauptachse, die aus der Haube oder dem oberen Teil des Mühlengebäudes herausragt und Von der vier bis acht Windflügel von jeweils drei bis neun Meter Länge strahlenförmig aus gehen. Die hölzernen Rahmen der Flügel sind entweder mit Segeltuch bespannt oder mit hölzernen Läden abgedeckt. Die Kraft der drehenden Hauptachse wird durch eine Reihe von Zahnrädern und Wellen auf die Mühle im unteren Teil des Gebäudes übertragen.
Zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert erfüllten Windmühlen neben dem Mahlen von Getreide und der Bewässerung von Ackerstand eine Vielfalt weiterer Aufgaben. Zu diesen Gehörte das Abpumpen von Meerwasser aus Gebieten die unter dem Meeresspiegel lagen, außerdem dienten Windmühlen zum Sägen von Holz, zur Papierherstellung, zum Ölpressen aus Samen und zum Mahlen unterschiedlicher Rohmaterialien. Insbesondere durch die Niederländer wurde der Windmühlenbau im 17. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert gefördert. Bis zum 18. Jahrhundert hatten die Niederländer annähernd 9000 Windmühlen gebaut. Zu den wichtigsten technischen Verbesserungen der Windmühle zählt eine im Jahr 1745 erfundene mechanische Einrichtung, die den Flügelteil der Mühle automatisch der jeweiligen Windrichtung anpasst (sogenannte Windrichtungsnachführung). Mit Hilfe dieser Konstruktion ließen sich die Flügel bei Wind aus unterschiedlichen Richtungen von selbst optimal in den Wind drehen. Die Schlitzöffnungen dieses Flügels konnten entweder von Hand oder automatisch in ihrer Größe verändert werden. Dadurch wurde eine gleichbleibende Drehgeschwindigkeit der Flügel bei wechselnder Windgeschwindigkeit möglich. Weitere Verbesserungen entwickelte man beispielsweise auch bei Bremsanlagen zum Anhalten des Windrades. Außerdem wurde die Form der Flügel weiterentwickelt. So verwendete man im 19. Jahrhundert propellerähnliche Tragflügel anstelle der herkömmlichen Flügel, um so die Leistung der Mühlen bei schwachem Wind zu erhöhen.
Mit Hilfe von Windkraftwerken wandelt man Windenergie in elektrischen Strom um, deshalb werden diese Kraftwerke auch als Windenergieanlagen bezeichnet. Man unterteilt diese Anlagen im wesentlichen in zwei Kategorien: Anlagen mit horizontallaufender Achse und solche mit vertikaler Achse. Bei Anlagen mit horizontallaufender Achse ist an einem Achsen-ende ein zwei- oder mehrblättriger Rotor installiert, der über ein Gebiet mit einem elektrischen Generator verbunden ist. Der Rotor wird zwecks optimaler Ausbeute mit Hilfe eines Computers in den Wind gedreht. Bei zu großer Windstärke wird der Rotor automatisch verriegelt. Die gebräuchlichste Konstruktion mit vertikaler Achse ist der sogenannte Darrieus-Rotor. Diese Maschine ist von der Windrichtung unabhängig und sieht im Prinzip so ähnlich aus wie ein Schneebesen. Ein Darrieus-Rotor kann jedoch nicht von selbst anlaufen. Deshalb werden Darrieus-Rotoren nicht anlaufenden Savonius-Rotoren kombiniert. Beim Savonius-Rotor stehen sich zwei gebogene, vertikal stehende Flügel gegenüber.
Das Windrad verfügt bei geringer Drehgeschwindigkeit über ein hohen Drehmoment und wird hauptsächlich zum Antrieb von Maschinen verwendet. Beispielsweise nutzt man Windräder in ländlichen Gebieten der USA zum Antrieb Wasserfördernder Pumpen. Diese Menschen haben einen Rotor mit einer Reihe schräg liegender Blätter, die strahlenförmig von einer horizontallaufender Achse ausgehen. Der Rotordurchmesser liegt gewöhnlich zwischen zwei bis fünf Metern. Ein großer ruderähnlicher Flügel der hinter dem Rotor angebracht ist, dreht das Rad in den Wind. Bei zu hoher Windstärke wird der Rotor mittels einer Sicherheitsvorrichtung automatisch aus der Windrichtung gedreht.
Windenergieanlage in Dänemark Wissenschaftler schätzen das bis Mitte des 21. Jahrhunderts zehn Prozent des Strombedarfs der gesamten Welt durch Windkraftwerke geliefert werden könnte. Gewöhnlich nehmen moderne Maschinen bei einer Windgeschwindigkeit von 19 Kilometern pro Stunde den Betrieb auf, erreichen ihre Nennleistung bei 40 bis 48 Kilometern pro Stunde und brechen den Betrieb bei Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro stunde ab. Am geeignetsten für Windkraftwerke sind Gegenden mit einer jährlichen Durchschnittsgeschwindigkeit von mindestens 21 Kilometern pro Stunde. Windenergie trägt nur in äußerst geringem Maße zur Umweltbelastung bei und ist somit eine wichtige Alternative zu den unwiederbringbaren Brennstoffen wie Erdöl. Die erfolgreichsten Windenergieanlagen für eine großangelegte Energiegewinnung sind von mittlerer Größe (von 15 bis 30 Metern im Durchmesser, mit Leistungen von 100 bis 400 Kilowatt). Manche Anlagen sind in Gruppen oder Reihen angeordnet und werden Windparks genannt.
Einige der größten Windparks der Welt stehen in Kalifornien. In Deutschland findet man Windenergieanlagen vor allem an der Nordseeküste. Der Beitrag der Windenergie zur Gesamtenergieversorgung ist derzeit noch gering. Gegen- wärtig bezieht Dänemark über zwei Prozent seines gesamten Strombedarfs über Windenergie. In der Europäischen Union liefern Windenergieanlagen etwa sechs Prozent der primären Energieerzeugung. Stromversorgungsnetze, Elektromotoren und Generatoren, Schutz natürlicher Ressourcen.